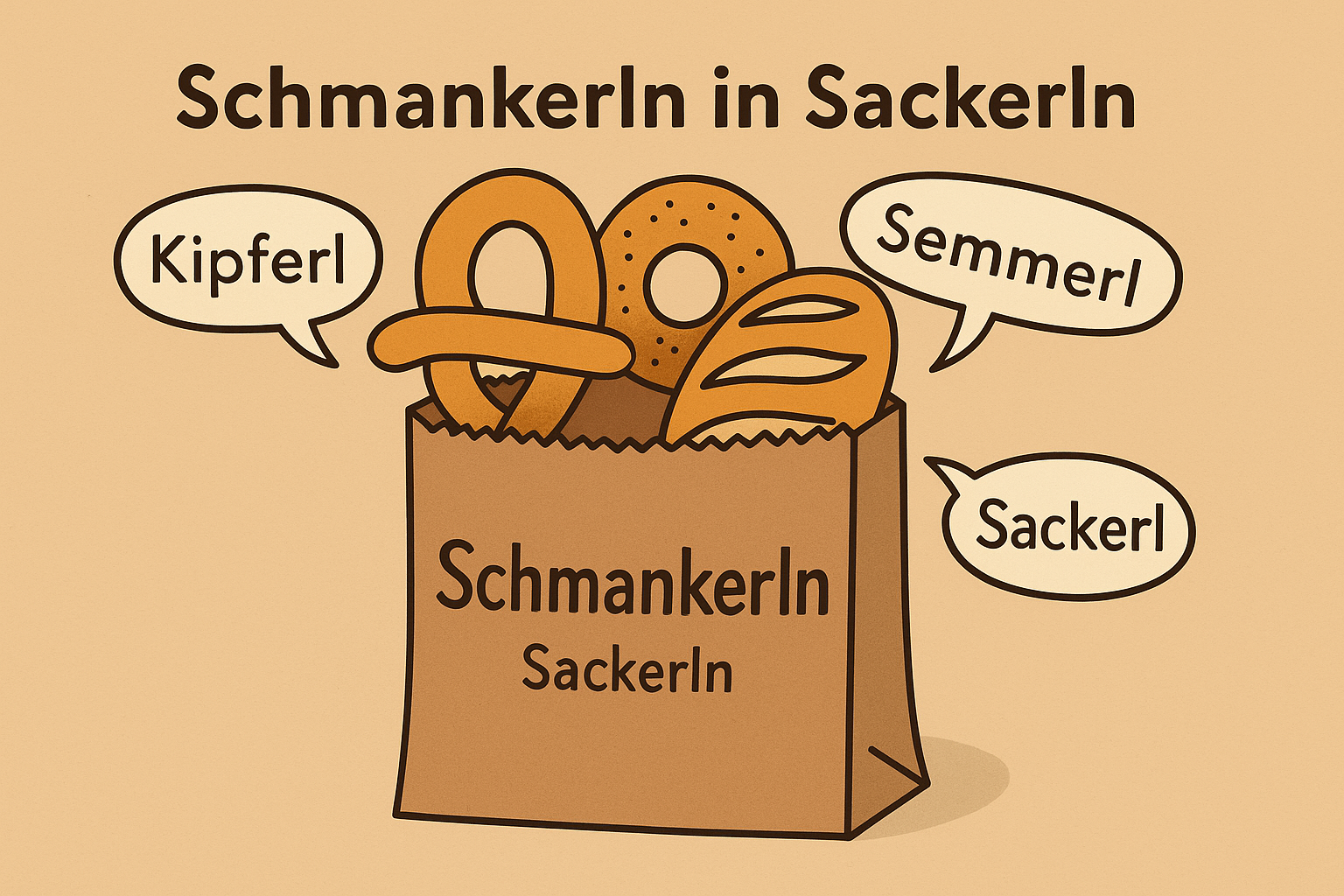Achtung, Amtsdeutsch! So schreibt man einfacher, besser und schöner
Irgendwo in einem Unternehmen in Österreich hing eines Tages dieser Zettel an der Toilettentür:
Diese WC-Anlage ist defekt. Bis zu deren Instandsetzung sind wir gezwungen, sie geschlossen zu halten. Wir danken für Ihr Verständnis!
„Was steht da auf dem Zettel?“, fragte eine Angestellte, die aus Bosnien stammt und ihr Deutsch gerade verbesserte, ihren Kollegen. „Das Klo ist kaputt, deshalb ist die Tür zu, tut uns leid“, beantwortete der Kollege ihre Frage. „Und warum steht das dann nicht so da?“, fragte Bosnierin.
Die Frau in unserem Beispiel, das ich in einem Internetforum entdeckt habe, hat damit eine Unsitte im deutschen Sprachraum aufgedeckt: einfache Dinge unnötig zu verkomplizieren. Was nutzt ein Hinweisschild, wenn es nicht verstanden wird?
Noch ein Beispiel, dieses Mal aus dem Vorwort eines Ratgebers:
Das gegenständliche Dokument enthält grundlegende Handlungs-, Umsetzungs- und Korrekturempfehlungen in technischem und organisatorischem Hinblick bezüglich Umsetzung der Vorgaben der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
Hier werden auch viele Menschen Probleme haben, diesen einleitenden Satz zu verstehen, noch dazu in einem Dokument, das Laien juristische Sachverhalte erklären soll. Übrigens: Man muss Deutsch nicht als Zweitsprache haben, um mit solchen Sätzen Probleme zu haben. Das geht vielen, wenn nicht den meisten Menschen so.
Ein Ursprung dieser komplizierten Schreibweise liegt im Sprachstil von Behörden, Verwaltungen und dem Rechtswesen, insbesondere auch bei Gesetzestexten. In diesen Zusammenhängen muss die Sprache klar und eindeutig sein. Dadurch erzeugt eine solche Sprache aber auch den Eindruck von Härte, Strenge und Unnachgiebigkeit – und Autorität. Ein weiterer „Schuldiger“ ist die wissenschaftliche Ausdrucksweise. Auch hier geht es um Klarheit und Eindeutigkeit, aber die Wirkung nach außen ist oft eine andere: Gelehrigkeit und Autorität.
Auch die Schule trägt meiner Meinung nach dazu bei, sich einen übermäßig komplizierten Stil anzueignen. Oft werden Aufsätze als „besser“ benotet, wenn sie möglichst lange Schachtelsätze enthalten, als wenn die Sprache, klar, einfach und schön ist. Diese „Misere“ verstärkt sich dann an der Universität, wo der sogenannte „elaborierte Stil“ Pflicht ist – dort ist er sinnvoll, im täglichen Leben jedoch nicht.
Und dann ist man plötzlich professionelle Schreiberin und soll Texte für Menschen schreiben! Man soll Texte produzieren, die Menschen gerne lesen, die Menschen verstehen, die Menschen nützen. Sich von den wiehernden Amtsschimmeln aus den Gelehrtenstuben und Schulbänken loszulösen, ist gar nicht so leicht. Sie lauern ständig im Hintergrund, auch noch nach vielen Jahren der Erfahrung. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man diesen Fallen entkommen kann.
Ein ganz einfacher ist, sich vorzustellen, jemandem den Inhalt des Textes zu erzählen. Oder man stellt sich diese Frage: Wenn ich nur eine Minute Zeit hätte, bis der Akku im Handy leer ist, wie würde ich diesen Sachverhalt meinem Gesprächspartner am besten erklären? Die Gedanken, die dann kommen, schreibt man am besten auf. Sie werden zu den Stichwörtern für den fertigen Text. Das Ergebnis ist eine Sprache, die natürlich wirkt, klar und deutlich ist und sich nicht in Schachtelsätzen oder Fremdwörterungetümen verheddert. Wenn man schreibt, wie man spricht, ist das Ergebnis optimal!
Zurück zu den Beispielen. Was wäre eine Alternative für ein Schild, das auf der Türe eines kaputten Klos hängt? Ich könnte mir Folgendes gut vorstellen:
Diese Toilette funktioniert nicht! Wir arbeiten daran, danke für Ihre Geduld.
Die Aussage ist klar, sie ist höflich, aber auch sympathisch und umgangssprachlich.
Und die Datenschutzgrundverordnung? Möglich wäre etwa so ein Einleitungstext:
Die neue DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) wirft viele Fragen auf. Wie muss ich mich als Unternehmen verhalten? Wie kann ich die Vorgaben am besten umsetzen? Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sollte ich ergreifen? Dieses Dokument gibt Antworten.
Den Monstersatz habe ich in kleine Happen zerschlagen. Ich habe einen Dialog geführt, der den Leser und die Leserin direkt anspricht. Und ich habe den tatsächlichen Zweck des Dokuments – nämlich Fragen zu beantworten – direkt angesprochen, ohne um den heißen Brei herumzuformulieren.
Einfach ist meistens besser – damit der Amtsschimmel nicht mehr wiehert.